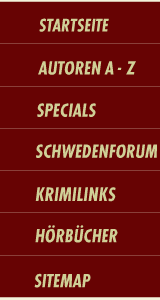Leseprobe
Leseprobe
Kapitel einsDas ist ein reichlich mieser Zaubertrick, von der Sorte, bei der ich einfach
nur noch wegsehen oder meinen kindischen Instinkten nachgeben und pfeifen
möchte.
Der kleine Ruck, mit dem sich die Maschinerie in Gang setzt, bringt die Blumen auf der Bahre für einen Moment zum Zittern. Das unendliche langsame Gleiten nach unten, so geschmeidig, so diskret, sorgt dafür, daß ich mich widerwillig und natürlich total umsonst bemühe, durch die Musik hindurch das Dröhnen der Motoren zu hören.
Aber vermutlich verwenden sie lautlose Hydraulik.
Danach werde ich von dem Gefühl überwältigt, daß der Sarg auf dem Fließband vom Katafalk gleich in die Flammen des Verbrennungsofens wandert.
Alle Tränen, die ich noch habe, erstarren in mir, schon ehe diese kleine Nummer des Verschwindens beendet ist.
Und dann bewegen wir uns, wir Lebendigen, über den Steinboden des Vestre-Krematoriums, und für mich hat die Mechanik jeglichen Glauben daran, daß er im Raum unter uns ruht, unmöglich gemacht, in diesem Moment spüre ich, daß er nicht ruht, sondern brennt. Und wie immer frage ich mich, ob wohl auch der Sarg verbrannt wird.Es liegt nichts Schönes darin. Die Flammen, die wir nicht sehen müssen, bringen keinerlei Läuterung.
Später gibt es Schnittchen, natürlich, und Sherry, bei Mutter und Karsten im Charlotte Andersens vei.
Ich sitze zwischen Mutters abgemagerter Verwandtschaft, die mit einer
Art lüsternem Appetit Roastbeef und Lachs verschlingt. Die Frau neben
mir hat ein munteres Funkeln in den eingesunkenen Augen über ihrer
riesigen aristokratischen Nase; ich nehme an, daß sie den leisen
Triumph genießt, daß Mutters jugendlicher Fehlgriff nun endgültig
begraben ist.
Keiner von seinen eher verhuschten Freunden, die auf der hintersten Bank in der Kapelle saßen, hat sich hierhergetraut.
Ich habe fürs erste meine Runden mit den Tabletts eingestellt, aber Benny ist zuverlässig mit einem neuen Glas Sherry hier und einem Stückchen Lachs dort zur Stelle. Ich weiß genau, warum. Er hat keine Lust, sich zu setzen, er fühlt sich so unendlich viel besser, wenn er sich bewegen, wenn er sich an etwas festhalten kann, und sei es auch nur an einem Plastiktablett aus der Bäckerei Samson.
Aber der Sherry kommt jetzt gut.
Als wir zusammen in die Stadt zurückgehen, leicht wackelig auf den Beinen, zeigt er plötzlich mit großer Geste auf die vorüberfahrenden Autos.
»Jedes davon hätte es sein können«,
sagt er.
»Ja«,
antworte ich, »und wir werden nie erfahren, welches genau es war.«
Wir trennen uns bei der Ampel im Blindernvei, und ich gehe allein zum Unigelände weiter. Als ich die schwere Tür des Helga-Eng-Hauses öffne, sehe ich, wie schon Hunderte Male, seit er überfahren wurde, sein zerschlagenes und geschwollenes Gesicht vor mir, und ich hoffe, daß diese violetten und krankhaft gelblichen Züge nicht meine Haupterinnerung an meinen Vater bleiben werden.
Ihre Bürotür ist angelehnt, und als ich hineinschaue, zieht sich Astrid gerade ihren exklusiven grauen Wollmantel an.
»Ich dachte, du wärst in Trondheim«,
sage ich, und meine Stimme muß sich vorwurfsvoller angehört haben, als mir klar war, denn für einen Moment scheint sie aus dem Gleichgewicht zu geraten.
»Wir waren früher fertig, als wir erwartet hatten«, antwortet sie. »Ich hätte es aber auf keinen Fall geschafft, zur Beerdigung zu kommen, Igi. Wie war es denn überhaupt?«
Ihre heisere Stimme ist schuld daran, daß ich am liebsten weinen würde, obwohl ich mir geschworen habe, daß ich mich nicht mehr bei ihr ausflennen werde. Schließlich ist sie jetzt meine Tutorin, nicht mehr meine Therapeutin.
»Die Beerdigung war schon in Ordnung, jedenfalls besser als die Eisshow danach.«
Sie lächelt, und nicht einmal ihre kleine viereckige Brille, die so gut zu ihren grauen Haaren paßt, schafft es, daß ihr Gesicht dabei streng aussieht.
»Und deine Mutter?«
Bei Psychologen hört sich »Mutter« immer so bedeutungsvoll an, und das liegt an der betont neutralen Art, in der sie dieses Wort aussprechen.
»Eiskönigin. Du weißt schon.«
»Perfekte Pirouetten?«
| Buchtipp |
 |
»Himmel, ja, unberührt von der Kälte. Weißt du schon, ob du zu der Tagung gehst?« füge ich hinzu, in einem durchsichtigen Versuch, nicht in die Patientinnenrolle zu verfallen.
»Ich glaube, ich will nicht hin. Und ich sehe eigentlich auch keinen Grund, warum du das tun solltest. Es geht da rein naturwissenschaftlich zu, und wahrscheinlich versteht man kein Wort. Ich will dich nicht beleidigen, aber du befaßt dich schließlich mit einer etwas weniger greifbaren Materie.«
Als ob ich das nicht wüßte! Als ob ich nicht wüßte, daß mein Versuch, Psychologie mit der physikalischen Chaosforschung zu verbinden, von halsbrecherischem Dilettantismus zeugt. Als ob das Exposé, das sie in der Hand hält, mein Bewußtsein dieser ungreifbaren Materie nicht geradezu ausstrahlte!
»Ich habe es noch nicht gelesen«,
sagt sie und steckt die Bögen in ihre Aktentasche, »aber am Wochenende fang ich damit an.«
Sie zupft sich den Seidenschal gerade, mit ihren schönen Händen, die ich in Augenblicken, in denen ich keine Lust hatte, ihre Fragen zu beantworten, so sorgfältig gemustert habe. Ein Hauch von ihrem Parfüm schwebt zu mir herüber, Giorgio, wie immer.
»Du mußt dir Zeit lassen, Igi«, sagt sie. »Forschung soll doch nicht leicht sein. Wenn die Antworten sich sofort einstellten, dann brauchten wir doch erst gar keine Fragen zu stellen, oder? Du willst doch jetzt wohl nicht noch arbeiten?«
»Doch.«
»Das finde ich wirklich ziemlich idiotisch. Du solltest dir lieber ein paar Tage freinehmen. Ich will dich hier morgen ganz einfach nicht sehen, okay?«
»Okay. Aber jetzt bleibe ich ein paar Stunden hier.«
»Mach, was du willst. Aber ich glaube nicht, daß du auf diese Weise irgendein Problem löst.«
Sie setzt den schwarzen Samthut ein klein wenig schräg auf und verläßt mich.
Ich habe durchaus nicht vor, Probleme zu lösen. Ich habe vor, mich in ihnen zu begraben.
Seine Stimme am Telefon klingt dünn wie eine Kinderstimme: »Igi«, flüstert er, »ich bin so verdammt ...«
Der Rest verschwindet in einem Schluchzer. Aber ich weiß, was er so verdammt ist. Unglücklich. Enttäuscht. Klein.
Und deshalb muß Igi kommen, schnell.
Auch gut. Es ist elf Uhr, während der letzten Stunden habe ich nur auf die seltsamen, farbenfrohen Muster auf dem Schirm vor mir gestarrt, wie schon so oft gefesselt von dem unglaublichen Reichtum an Variationen. Aber das ist nicht produktiv. Ich starre und rauche, starre und rauche. Der Aschenbecher in meinem geliehenen und eigentlich rauchfreien Arbeitszimmer ist so voll, wie mein Kopf leer ist.
Ich öffne die Ausgangstür des Helga-Eng-Hauses mit meiner Plastikkarte. Die eisige Kälte der letzten Tage kühlt auf dem Weg zur U-Bahnhaltestelle bis auf weiteres meine Stirn und säubert mein Gehirn. Aber nur bis auf weiteres.
Als ich die steile Treppe zur Bar hinuntergegangen bin, gerate ich in Luft, die noch verräucherter ist als die im Arbeitszimmer. Sie ist dicht wie die Reihe von schwarzen Lederjacken am Tresen. Außerdem hängt hier eine Auswahl von teuren Rasierwassern in der Luft, und zwar so großzügig verwendet, daß sie sogar meinen geschwächten Geruchssinn erreicht.
Wie üblich bin ich mir hier unten meiner unangebrachten Weiblichkeit unangenehm bewußt, und deshalb brauche ich eine Weile, bis ich ihn entdecke.
Er sitzt allein da, wie ich es erwartet hatte, und seine Wimperntusche verläuft schon, wie ich es erwartet hatte.
Hier ist nicht der richtige Ort zum Weinen, wenn man zu den harten Jungs gehören will.
Aber genau das war noch nie Bennys Ziel.
»Ist er nicht gekommen?«
frage ich überflüssigerweise, als ich mich ihm gegenüber auf einen unbequemen Hocker gesetzt habe.
Er schüttelt den Kopf.
Ich weiß es. Ich weiß, wenn er jetzt spricht, dann wird er wieder weinen. Er fühlt sich erniedrigt, und diese Erniedrigung kann er nur mir zeigen.
Mir, und den anderen Jungs in der »Schwarzen Witwe«.
Ich hole mir auch ein Bier, nicht, weil ich Lust darauf habe, sondern, um ihn nicht durch nervende Nüchternheit zu verletzen.
Denn Benny hat einiges getrunken, weil seine Verabredung sich zerschlagen hat.
Wir waren schon öfter hier, Benny und ich. Hier und in anderen Lokalen, wo ich durch meine Weiblichkeit ebenso auffalle wie Benny normalerweise mit seiner. Ich habe eine ganze Welt, durch die ich auf Stöckelschuhen wandern kann, Benny hat nur dies hier und ein paar ähnliche Lokale.
Wir halten uns über dem Tisch an den Händen.
Das macht nichts, es kommt öfter vor, daß Jungs wie Benny eine beste Freundin wie mich haben...( Kapitel eins gekürzt )
Kapitel zwei
Bennys Rücken wärmt meinen Bauch, als ich mich an ihn schmiege, und in seinem Nacken hängt noch der Duft eines Rasierwassers, das nicht seines ist. Ich drehe mich aus Wärme und Duft heraus und liege jungfräulich kerzengerade neben ihm, angespannt im Raum zwischen Schlaf und Wachsein, dem Raum, in dem böse Träume gedeihen.
Er weiß alles über Trauer und Katerstimmung, und deshalb läßt er mich lange duschen und serviert mir Saft und frischgebackenes Brot, ohne auch nur den Mund aufzumachen. Ich sitze in seinem Frotteebademantel am Küchentisch und zerpflücke das Brot gewissenhaft in kleine Bröckchen.
Er stellt zwei Tassen mit Espresso und heißer Milch zwischen uns auf den Tisch. Die beiden blauen Tassen, die er mir vor ein paar Jahren gekauft hat, warum, habe ich vergessen, aber es sind die schönsten Tassen, die ich kenne, eine der vielen Folgen seines niemals irrenden guten Geschmacks.
»Du?«
sage ich.
»Ja?«
Ich zerbrösele noch mehr Brot. Er hat den Espresso mit genau der richtigen Menge Milch gemischt.
»Fändest du es schrecklich, wenn ich ein paar Tage verschwinden würde?«
Er sieht mich aus großen, ungeschminkten Augen an.
»Wohin willst du denn?«
»Ich dachte, ich könnte in der Bernt Ankers gate übernachten. Ein paar Tage. Eine Weile. Ich weiß nicht.«
Er steht auf und gießt vorsichtig Wasser in den Untersetzer der Basilikumpflanze, die an der Küchentischkante vor dem Fenster steht.
»Zweimal täglich«, sagt er.
»Was?«
»Die muß zweimal täglich gegossen werden, das ist der Trick«, sagt er. »Sonst stirbt sie. So einfach ist das. Zweimal täglich.«
Sagt er, mein Benny, obwohl wir beide wissen, daß solche Ratschläge bei mir vergeudet sind, ich gieße entweder zu oft oder zu selten, aber niemals, niemals genau richtig.
»Du wirst mir schrecklich fehlen«, sagt er, als das Telefon klingelt.
Es ist Mutter.Ihre Stimme ist laut und schrill, wie immer, wenn sie mich privat anruft. Sie will wissen, was ich zur Beerdigung zu sagen habe.
»Ach, die war in Ordnung.«
»Mußt du nicht arbeiten?«
»Nein. Wie du hörst.«
Benny hat die Anlage laut genug gestellt, um sich unser Gespräch nicht anhören zu müssen. Es singt Karin Krog.
»Wo ist - Benny denn?«
Man muß ihre Tochter sein, um die winzige Pause vor seinem Namen zu hören, als ob sie Anlauf nimmt oder seinen Namen vergessen hat.
»Der ist hier. Er macht Frühstück für mich.«
»Ach. Und wart ihr gestern vielleicht aus?«
»Ja. Benny jedenfalls.«
»Ach so.«
Auf irgendeine Weise bringt Mutter mich immer dazu, mich so auszudrücken, als ob Benny und ich schreckliche Probleme hätten, und das liegt daran, daß sie mit geheimnisvollem mütterlichem Gespür immer gerade dann anruft, wenn das der Fall ist. »Spring can really hang you up the most«, singt Karin Krog, als ich auflege, aber es ist noch längst nicht Frühling, auch wenn Benny energisch so tut - ich kann ihn durch die Türöffnung sehen, er steht bei seinen geliebten Grünpflanzen im Wohnzimmer und gießt sie gewissenhaft.
»Mach das, du«, sagt er, noch immer mit dem Rücken zu mir. »Das tut dir sicher gut.«
Seine Stimme ist weich und leise, um die Pflanzen nicht zu beunruhigen. »Und was hast du im Grunde schon von mir!«
»Hör auf damit. Es ist doch bloß für kurze Zeit, und inzwischen hast du sturmfreie Bude für deine Jungs.«
»Niemals«, antwortet Benny und dreht sich um, aufrichtig verletzt. »Niemals hier.«
Und das weiß ich ja. Mitten in seinen wechselnden und heftigen Verliebtheiten ist Benny treuer als ich, die niemals versucht, auf der Piste Jungs aufzutun.
Er glaubt, daß ich so brav lebe, weil ich mir im Grunde eine Ehefrau wünsche und weil er meine Bedürfnisse nach weiblicher Fürsorge erfüllt. Aber das wird zu kompliziert für mich. Wie so vieles.
Und gerade jetzt, gerade heute, gibt es hier zu viele gelb angestrichene Wände, zu viel frische grüne Freundlichkeit, die unter seinen Händen lebt, zu viele angenehme materielle Spuren von Jahren des Zusammenlebens, die Ansprüche an mich stellen, um ihm zu sagen, daß ich ihn liebe, daß ich nur nicht weiß, wie zum Teufel ich es schaffen soll, weiter mit ihm zusammenzuleben.
Als ob ich je vorgehabt hätte, ihm das zu erklären, denke ich, als ich leise die Tür hinter mir schließe, mit Tasche und Notebook in der Hand, als ob er das nicht besser wüßte als ich.
Die Staubkörner gleiten träge durch das langgestreckte Rechteck aus Licht auf dem Linoleum, und sie sind das einzige, was sich von meiner Anwesenheit bewegen läßt.
Die Gegenstände, die meine Übernahme markieren sollten, sehen armselig und nichtssagend aus, als sie vor mir auf dem Boden stehen: ein Versuch, fremdes Territorium zu erobern, so erbärmlich wie Armstrongs Flagge auf dem Mond oder Kolumbus' Kreuz an einem kubanischen Strand. Und wie im Meer des Schweigens um den Astronauten oder im Dschungel vor dem Conquistadoren herrscht Stille in den Schatten um mich herum; kein Geheimnis wird mir hier verraten werden, dieses Zimmer wird sich meiner Forderung, gesehen zu werden, nicht beugen, die Träume, die hier gelebt haben, werden mir verborgen bleiben. Tasche und PC, die dort im Rechteck aus Licht stehen, sind die Requisiten einer Niederlage, nicht des Sieges, können ebensowenig eine Kapitulation erzwingen wie Kreuz oder Flagge. Bloß, weil ich sie hier abgestellt habe, gehört mir das Zimmer noch lange nicht, und die kindische Forderung, die sie symbolisieren, wird nur durch tödliches Schweigen beantwortet.
Ich weiß, was sie sagen, diese Eindringlings-Requisiten.
»Vater«, sagen sie. »Hier bin ich. Wo hast du deine Schätze versteckt?«
Und die Kapitulation des Zimmers ist wohl die, die auch anderen Eroberern zuteil wird. Was hier gelebt hat, hat sich einen Schritt zurückgezogen, in die Schatten, in den Dschungel, ins Meer des Schweigens. Elvis has just left the stage.
Als ich die Nummer wählen will, die er auf dem Briefumschlag notiert hat, bleibe ich einen Moment lang mit dem Hörer in der Hand stehen.
Der kleine Anrufbeantworter, den Benny und ich ihm einmal geschenkt haben, und den er an den Tagen benutzt hat, an denen er sich nicht auf seine Stimme verlassen konnte, steht neben dem Telefon. Dort lebt seine Stimme noch immer.
Rasch wähle ich die Nummer. Eine Frauenstimme antwortet. Sie klingt, als ob ich sie geweckt hätte.
»Siv Underland?« frage ich.
»Was? Nein, die wohnt nicht mehr hier.«
»Haben Sie vielleicht ihre neue Nummer?«
»Ich glaube, sie hat gar kein Telefon.«
»Aber sie hat doch sicher eine Adresse?«
»Moment.«
Sie nennt mir die Adresse, die auf dem Umschlag steht.
Ich bedanke mich und lege auf. Und schalte den Anrufbeantworter nicht ein.
Danke an den randomhouse/btb Verlag für die Veröffentlichungserlaubnis. |